Es gibt bisher noch keine Kommentare.
| Soziale Ungleichheit gefährdet Ihre Gesundheit |
| Archiv - KORSO Sozial FORUM - Schwerpunkt: Sozialstaat | |
| Donnerstag, 1. Juni 2006 | |
 Ein funktionierender Sozialstaat ist lebensnotwendig – und das unter zwei Gesichtspunkten: Zum einen, weil er die Mittel bereitstellt, die für Vorsorge und Behandlung benötigt werden. Zum zweiten, weil er durch Umverteilung gesellschaftliche Ungleichheit abmildert. Ein funktionierender Sozialstaat ist lebensnotwendig – und das unter zwei Gesichtspunkten: Zum einen, weil er die Mittel bereitstellt, die für Vorsorge und Behandlung benötigt werden. Zum zweiten, weil er durch Umverteilung gesellschaftliche Ungleichheit abmildert. Denn alle einschlägigen Untersuchungen zeigen: Arme sind häufiger krank und sterben früher als Wohlhabende. Besonders bestürzend: Das Sterberisiko sozial benachteiligter Gruppen ist im Verhältnis zu jenem der Reichen in den letzten zwei Jahrzehnten parallel zur Zunahme der gesellschaftlichen Ungleichheit angestiegen.
 „Die Diagnose ist klar", sagt Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Freidl vom Institut für Sozialmedizin der Medizinuniversität Graz: „Wer ein geringes Einkommen und geringe Bildung hat, stirbt durchschnittlich früher als Menschen mit höherem Einkommen und höherer Bildung." Für Österreich liegen laut Freidl bloß 25 Jahre alte Daten vor, die diese These bestätigen; aber EU-weite Erhebungen, die für eine im Februar 2006 im Auftrag der Union erschienene Studie ausgewertet wurden, belegen ihre Gültigkeit für ganz Europa. „Die Diagnose ist klar", sagt Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Freidl vom Institut für Sozialmedizin der Medizinuniversität Graz: „Wer ein geringes Einkommen und geringe Bildung hat, stirbt durchschnittlich früher als Menschen mit höherem Einkommen und höherer Bildung." Für Österreich liegen laut Freidl bloß 25 Jahre alte Daten vor, die diese These bestätigen; aber EU-weite Erhebungen, die für eine im Februar 2006 im Auftrag der Union erschienene Studie ausgewertet wurden, belegen ihre Gültigkeit für ganz Europa.„Die Ungleichheit bei der Sterberate ist in den letzten Jahrzehnten substanziell angestiegen". Studienautor Prof. Johan Mackenbach von der medizinischen Fakultät Rotterdam kommt zum beunruhigenden Schluss: „Das Ausmaß dieser Ungleichheit ist oft substanziell, die niedrigsten sozialen Gruppen haben oft ein Mortalitätsrisiko, das 25-50 Prozent höher ist als der Durchschnitt, in manchen Fällen sogar 150 Prozent höher. Darüber hinaus ist aber auch die Ungleichheit in der Mortalitätsrate in den letzten Jahrzehnten markant angestiegen:" Erklärungen dafür, so Mackenbach, gebe es nur zum Teil; ein Grund dürfte in der Tatsache liegen, dass die Mortalität zwar in allen sozialen Gruppen zurückgeht, die sozial besser Gestellten aber mehr von den Verbesserungen des Gesundheitsverhaltens profitieren konnten. Dieser Befund deckt sich mit einer Untersuchung über den Gesundheitszustand der Bevölkerung, die in 27 ländlichen Gemeinden der Steiermark 1995 und 1998 durchgeführt wurde und die Freidl gemeinsam mit seiner Kollegin Dr. Christine Neuhold in 10 dieser Gemeinden zwischen 2001 und 2005 im Auftrag des Fonds „Gesundes Österreich" wiederholte; in der Zwischenzeit hatte die Gesundheitsförderungs-Initiative „Styria Vitalis" verschiedene Programme in den betroffenen Gemeinden durchgeführt. Das Resümee der Studie: Die Gesundheitsförderungsprogramme haben nachweislich zu einer Verbesserung der Gesundheitsindikatoren der Bevölkerung beigetragen, aber: „Am stärksten profitieren jene Bevölkerungsgruppen, die der mittleren und höheren Bildungsschicht angehören sowie über ein höheres Einkommen verfügen." Geraubte Lebensjahre. Das höhere Mortalitätsrisiko schlägt sich in einer geringeren Lebenserwartung nieder: „Der Unterschied in der Lebenserwartung zwischen den niedrigsten und den höchsten sozialökonomischen Gruppen bewegt sich zum Zeitpunkt der Geburt typischerweise in der Größenordnung von 4 bis 6 Jahren bei Männern und 2 bis 4 Jahren bei Frauen, aber in Einzelfällen wurden auch größere Unterschiede beobachtet. So ist in England und Wales die Ungleichheit der Lebenserwartung ab der Geburt unter Männern von 5,4 Jahren in den Siebzigern auf über 8 Jahre in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts gestiegen", konstatiert Mackenbach. Eine ähnlich starke Zunahme der Ungleichheit in der Lebenserwartung wurde, so die Studie, auch in Finnland beobachtet. Auch die Kindersterblichkeit, die generell überall in Europa gesunken ist, wird nach wie vor maßgeblich von den sozialen Bedingungen bestimmt: Zwischen 1987 und 1997 ist sie innerhalb gesellschaftlicher Gruppen mit höherer Bildung auf einen signifikant niedrigeren Wert gefallen als bei Gruppen mit Pflichtschulabschluss. Ebenso ungleich verteilt wie die Mortalität sind naturgemäß die Krankheiten und Gründe, die letztendlich zum Tode führen; das betrifft im Besonderen Herz- und Gefäßerkrankungen und alkoholbedingte Krankheiten und Vorfälle (Leberzirrhose, Selbstmord, Unfälle, Gewalttaten …). Arm macht herz- und zuckerkrank. Auch diese Ergebnisse der internationalen Studie finden ihre Bestätigung in Forschungsergebnissen aus der Steiermark. Im ersten Durchgang der erwähnten Untersuchung in Landgemeinden gaben etwa 13,2% der befragten SteirerInnen mit Pflichtschulabschluss an, sie fühlten sich sehr gut, bei jenen mit Matura sind es hingegen 32,8%. 19,1% der PflichtschulabgängerInnen fühlen sich gesundheitlich eher schlecht bis sehr schlecht, bei den MaturantInnen und AkademikerInnen sindes nur 5,1%. Nur 13,9% der BezieherInnen eines Einkommens unter 872,-- Euro gaben an, sich gesundheitlich „sehr gut" zu fühlen, aber nahezu doppelt so viele aus der Einkommensklasse über 2180,-- Euro. Das subjektive Gesundheitsgefühl trügt nicht – auch die objektive Häufigkeit von Erkrankungen hängt von Einkommen und nicht zuletzt von der Schulbildung ab. o 25,2% der Schlechtestverdienenden leiden unter Bluthochdruck, aber nur 10,4% der BestverdienerInnen o 2,8% der Schlechtestverdienenden hatten im Lauf ihres bisherigen Lebens einen Herzinfarkt, aber nur 1,1% der BestverdienerInnen o 7,5% der untersten Einkommensklasse leiden an Diabetes, aber nur 3,5% der höchsten Einkommensklasse o Bei 26% der Einkommensschwächsten treten Nervosität, Müdigkeit untertags und Schlafstörungen alle paar Tage auf, aber nur bei 16% der höheren Einkommensgruppen – bei Personen mit Matura- und Universitätsabschluss sind es gerade 7%. Gleichheit verlängert das Leben und macht gesund. Die Schlüsse des Medizinsoziologen Freidl sind ebenso eindeutig wie seine Diagnose: „Wenn heute immer stärker die Ansicht vertreten wird, dass Gesundheit eine Folge individuellen Verhaltens und jeder selbst für seinen Gesundheitszustand verantwortlich sei, so spiegelt das mehr die ideologische Verfasstheit der Gesellschaft wider als die Realität. Die vielfach ausgesprochene Forderung, die gesundheitliche Versorgung sowie die Vorsorge der Selbstverantwortung des Individuums und der Familie zu überlassen, berücksichtigt nicht, dass es in sozial benachteiligten Milieus die Rahmenbedingungen dafür nicht gibt. Die Selbstverantwortung für die Gesundheit kann hier gar nicht zum Tragen kommen. Als Ergebnis wird nicht nur die Schere der Sozialschichtunterschiede weiter geöffnet, sondern es wird auch die Schuld dafür noch zusätzlich den benachteiligten Menschen zugeschoben." Gesamtgesellschaftlich wirksame Gesundheitsförderung muss also deutlich über die bisherige Praxis von gesunder Schuljause und Bekämpfung des „inneren Schweinehundes" hinausgehen – Letzteres ist im Übrigen die Strategie des Gesundheitsministeriums, das unter www.isch.at heiße Tipps verbreitet, wie diesem krank machenden Unsympathler entgegengetreten werden kann. „Ein freier Zugang zum Bildungswesen ohne soziale Hemmschwellen, der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, bessere Möglichkeiten zur Teilnahme am kulturellen Leben und letztendlich ein Schließen der Kluft zwischen Arm und Reich sind die effizientesten gesundheitspolitischen Maßnahmen", betont Freidl. In der Tat zeigen die Ergebnisse internationaler Studien: Je egalitärer eine Gesellschaft ist, desto gesünder sind die Menschen. Äußerst aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang der Vergleich zwischen der Lebenserwartung in verschiedenen Staaten und der Verteilung der Haushaltseinkommen. Hier schneiden etwa Länder wie Schweden oder Norwegen, wo relativ egalitäre Einkommensverhältnisse herrschen, deutlich besser ab als etwa die USA oder Großbritannien. Der Medizinsoziologe Richard G. Wilkinson erklärt das so: Geringere Unterschiede zwischen Arm und Reich bedingen einen besseren sozialen Zusammenhalt; die Menschen erleben sich weniger als inkompetent, inferior und konkurrenzierend und von weniger Scham und Ängstlichkeit belastet. Solche Gesellschaften entwickeln auch einen ausgewogeneren Sozial-ethos – in Ansätzen trifft das in Europa auf die skandinavischen Gesellschaften zu. 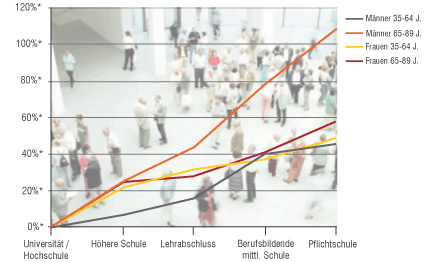 Zusätzliches Sterberisiko nach Geschlecht, Altersgruppe und höchster abgeschlossener Bildungsgruppe – bezogen auf die höchste Bildungsgruppe (gesamtösterreichische Sterbefälle Mai 81 bis Mai 82), Quelle: Doblhammer-Reiter 1996: Soziale Ungleichheit vor dem Tod. Demographische Informationen 1995/96, 71-81 Zusätzliches Sterberisiko nach Geschlecht, Altersgruppe und höchster abgeschlossener Bildungsgruppe – bezogen auf die höchste Bildungsgruppe (gesamtösterreichische Sterbefälle Mai 81 bis Mai 82), Quelle: Doblhammer-Reiter 1996: Soziale Ungleichheit vor dem Tod. Demographische Informationen 1995/96, 71-81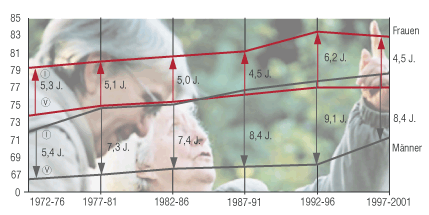 Die Lebenserwartung nach sozialen Schichten (I-V) und Geschlechtern in England und Wales 1972 bis 2001: Die Ungleichheit wuchs vor allem während der Thatcher-Ära. Die Lebenserwartung nach sozialen Schichten (I-V) und Geschlechtern in England und Wales 1972 bis 2001: Die Ungleichheit wuchs vor allem während der Thatcher-Ära.Quellen: Wolfgang Freidl, Christine Neuhold: Gesundheitssurveyforschung im regionalen Setting. Gesundheitsberichterstattung in der Steiermark unter Berücksichtigung psychosozialer Aspekte. Frankfurt/Main: VAS 2002 Johan Mackenbach: Health Inequalities: Europe in Profile. Hrsg. von der Generaldirektion für Gesundheit und Konsumentenschutz der EU-Kommission, Februar 2006. Richard G. Wilkinson. Kranke Gesellschaften. Wien, New York: Springer, 2001
» Keine Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.
» Kommentar schreiben
Nur registrierte Benutzer können Kommentare schreiben.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich. |
|
| < zurück | weiter > |
|---|