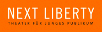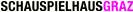|
Kopfzeile - von Martin Novak Um ein britisches Pfund kann man nicht einmal ein Exemplar des Standard oder des Wirtschaftsblatts kaufen, aber angeblich den britischen Evening Standard. Jedenfalls hat das der ehemalige KGB-Offizier und Oligarch Alexander Lebedew um diesen kolportierten Preis getan – nicht ein Exemplar wohlgemerkt, sondern drei Viertel der Eigentumsrechte.
Ja, Zeitungen sind dieser Tage günstig zu haben, wenn man sich die Abdeckung der Schulden und die Investitionen leisten kann. Es geht ihnen nämlich mies. Das Beste, was man über die wirtschaftliche Lage der US-Tageszeitungen sagen kann, ist, dass sie im Vergleich zur Automobilindustrie eine quantitée négligable ist. Das ist aber auch schlecht: Die Zeitungsindustrie ist definitiv nicht „too big to fail“. Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, können wir auf Zeitungen verzichten, ohne dass das BIP oder die Arbeitslosenquote sich nennenswert verändern.
Den hiesigen Zeitungen geht es besser. Qualitätsmedien halten ihre Auflagen: „Wenn Mediennutzer die Weltwirtschaftskrise erklärt bekommen wollen, gehen sie nicht zu Twitter“, sagte kürzlich Zeit-Herausgeber Josef Joffe den Zeitungen eine glänzende Zukunft voraus. Aber die Inserateneinnahmen brechen ein. Was Standard-Herausgeber Oscar Bronner knapp auf den Punkt bringt: „Zeitungen werden damit leben müssen, mit weniger Geld auszukommen.“ Das Zitat stammt aus dem Standard, also wird es stimmen. Dann sagte Bronner noch: Verleger müssten weiterhin Qualitätsjournalismus ermöglichen. Wie das gehen soll, wenn das Geld knapp wird, sagte er nicht, zumindest hat der Standard nichts darüber geschrieben. Das muss er aber auch nicht: Denn wie Medien mit weniger Geld auskommen, kennt man von den Sanierungsplänen des ORF: weniger Auslandskorrespondentinnen, überhaupt weniger Personal, billigere Inhalte – weniger Qualität(sjournalismus) eben.
Jammern wir nicht, tun wir was. Stellen wir uns eine fiktive Zeitung vor. Sie setzt 150 Millionen Euro pro Jahr um, zwei Drittel, 100 Millionen kommt aus der Werbung, 50 Millionen zahlen die Leserinnen. Reduzieren sich die Werbeeinnahmen um ein Fünftel, bleiben in Summe nur mehr 130 Millionen. Das ist grundsätzlich schlecht, erhöht aber den Einfluss der Leserinnen. Um fast 16 Prozent. Wir wollen aber noch mehr. „Gute Inhalte kosten viel Geld, und ich bin überzeugt, dass der Konsument auf Dauer bereit ist, einen angemessenen Preis zu bezahlen“, hofft Gruner+Jahr Aufsichtsrat Axel Ganz im Interview mit einem deutschen Online-Medienportal.
Beweisen wir, dass er Recht hat: Ab sofort bezahlen alle ihre Sonntagszeitung. Das hilft zwar nicht viel, weil die Zeitungen so viele Abonnenten haben, ist aber ein Signal: Wir wollen tatsächlich den Qualitätsjournalismus retten. Die (fiktive) Zeitung erhöht jetzt ihren Preis. Sagen wir, von 20 auf 30 Euro für das Monatsabo. Das wären dann schon 72 Millionen Euro pro Jahr (bei gleichbleibender Käuferinnenzahl), 152 Millionen trotz reduzierter Werbeeinnahmen. Dafür wollen wir aber etwas. Ein Modell dafür hat die Katholische Kirche schon entwickelt: Die Zahlerinnen dürfen mitentscheiden, wofür ihr Geld verwendet wird. Wir Leserinnen wollen mitbestimmen, welche Themen von der Zeitung recherchiert und qualitätsjournalistisch aufbereitet werden. Da hätte dann auch das beliebte SMS-Voting einen Sinn.
Martin Novak ist Journalist, Medienfachmann und Geschäftsführer der Agentur „Conclusio“ in Graz.
* Wir erinnern uns: Seit dem letzten Monat wird in dieser Kolumne die weibliche Form verwendet, wenn Frauen und Männer gemeint sind. Ausgenommen sind Zitate.
» 1 Kommentar
1"Geld für Journalismus"
am Dienstag, 17. März 2009 16:49
Ein Geschäftsmodell für Online-Journalisten gibt es hier (ziemlich lang, ganz hab ich es noch nicht verstanden, Aber es gibt Geld. http://www.editorandpublisher.com/eandp/columns/stopthepresses_display.jsp?vnu_content_id=1003940234
» Kommentar schreiben
Nur registrierte Benutzer können Kommentare schreiben.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich.
|